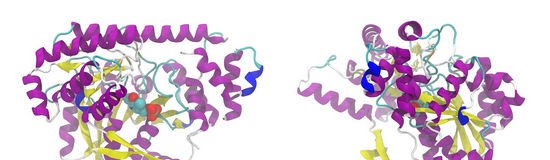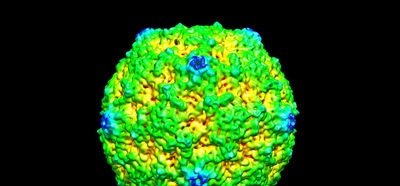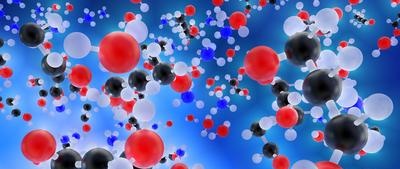Wie Proteinstrukturen aufgebaut werden |
|
Die Untersuchung biologischer Strukturen, ihrer Zusammensetzung und molekularen Organisation, ihrer spezifischen Aktivität ist Gegenstand der Molekularbiologie geworden. Der Erfolg des letzteren hängt hauptsächlich mit der Entschlüsselung der Struktur von Nukleinsäuren und der Art der Erbinformation zusammen. Ein Nukleinsäuremolekül ist eine lineare Sequenz von vier Arten von Nukleotiden, die in einer komplexen, aber genau definierten Reihenfolge angeordnet sind und mit der regulären Anordnung von Buchstaben in einem aussagekräftigen Text verglichen werden können. So wie ein Text eine Botschaft, eine Information enthält, enthält die Reihenfolge der Nukleotide in einem Nukleinsäuremolekül Informationen über die einzelnen Strukturen von Proteinen, die beim Aufbau eines Organismus erzeugt werden sollen. Ein Proteinmolekül ist auch eine lineare Sequenz von Strukturelementen, jedoch keine Nukleotide, sondern zwanzig Arten von Aminosäuren. Jede Kombination von drei Nukleotiden in einem Nukleinsäuremolekül (genetischer Code) bestimmt den Einschluss der einen oder anderen der zwanzig Aminosäuren. Die Sequenz der Nukleotidtripletts bestimmt die genaue Sequenz der Aminosäuren im synthetisierten Proteinmolekül. Wenn wir den bereits allgemein akzeptierten Vergleich genetischer Informationen mit geschriebenem Text fortsetzen, können wir sagen, dass während der Proteinsynthese der in der Nukleotidsprache geschriebene Text in die Sprache der Aminosäuren übersetzt wird. Die im Aminosäuretext eines bestimmten Proteintyps enthaltenen Informationen - dh die Zusammensetzung und Sequenz der Aminosäuren, die ihm allein innewohnen - bestimmen seine Form und subtile innere Organisation - die räumliche Ordnung der Strukturelemente, von denen bestimmte seiner biologischen Funktionen abhängen. Wenn diese Ordnung gestört ist, verlieren beispielsweise Enzymproteine die Fähigkeit, Reaktionen im Körper zu katalysieren. Studien haben gezeigt, dass bestimmte Funktionen eines Proteins direkt durch Assoziationen chemischer Gruppen ausgeführt werden, die sich in bestimmten Teilen eines geordneten Proteinmolekül-spezifischen Funktionszentrums befinden. Wenn die Ordnung gestört wird - zum Beispiel ein Proteinmolekül schmilzt -, erhalten die Kombinationen chemischer Gruppen die Möglichkeit, ihre gegenseitige Anordnung zu ändern. Streu- und Funktionszentren existieren nicht mehr. Somit ist die Übersetzung der Nukleotidsprache in die Sprache der Aminosäuren nicht nur eine Übersetzung. Aminosäurebuchstaben enthalten einen viel höheren physikalischen und chemischen Gehalt als Nukleotidbuchstaben. Und im Allgemeinen unterscheidet sich die von einem Proteinmolekül getragene Information grundlegend von der Nukleotidinformation, da sie auch die Spezifität der Struktur von Proteinmolekülen und ihre subtilsten biologischen Funktionen bestimmt. Ein weiterer Vergleich kann aus dem technischen Bereich gemacht werden. Die in Nukleinsäuren enthaltenen Informationen sind wie Blaupausen, aus denen Teile in einer bestimmten Reihenfolge hergestellt und zusammengesetzt werden. Ein Proteinmolekül ist ein zusammengesetzter Mechanismus, und die in der Sequenz seiner Aminosäuren enthaltene Information ist das Programm des Mechanismus selbst. In einer lebenden Zelle fungieren die meisten Proteine nicht in einem freien Zustand, sondern als Bestandteile komplexer Strukturen - ausgewogene und kontrollierte Systeme, in denen jedes Protein einen bestimmten Platz und einen bestimmten Anteil an der gesamten physiologischen Funktion hat. Der Aufbau komplexer Zellstrukturen ist ein dialektischer Übergang vom Bereich der Chemie (der die Funktion einzelner Proteinmoleküle umfassen sollte) zum Bereich der Biologie. Komplexe biologische Strukturen enthalten neben Proteinen auch Lipide, Kohlenhydrate und andere Substanzen.Beim Aufbau komplexer intrazellulärer Strukturen ist die Rolle dieser Substanzen jedoch nicht die führende. Kohlenhydrate und Lipide können aufgrund ihrer chemischen Struktur einfach nicht die sehr große Menge an Informationen enthalten, die für eine solche Konstruktion erforderlich sind. Die wichtigste Rolle dabei sind bestimmte Proteine. Die heutige Molekularbiologie bestätigt und detailliert somit die bekannte Position von F. Engels zu Proteinen als Lebensgrundlage. In Proteinen, in denen unendlich unterschiedliche Moleküle aus Strukturelementen mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften aufgebaut sind und in denen die Präzision einer einzigartigen Organisation mit Flexibilität und Plastizität kombiniert wird, hat die Natur ein außergewöhnliches Material gefunden, das es ermöglicht, eine höhere biologische Form der Materiebewegung zu erzeugen. Das Vorhandensein spezifischer Zentren ist eine gemeinsame Eigenschaft von Proteinen, die spezielle biologische Funktionen erfüllen. Dies sind die "Arbeitsorgane" von Proteinmolekülen. Dank spezieller spezifischer Zentren binden Enzymproteine selektiv Substanzen, deren Katalysatoren für chemische Transformationen Antitoxinproteine, Bindungstoxine usw. sind. Bei Kontakt wird ein System von Wechselwirkungen zwischen den chemischen Gruppen eines bestimmten Zentrums und einem Partnermolekül organisiert. Es umfasst zum einen die elektrostatische Anziehung zwischen Gruppen mit entgegengesetzten elektrischen Ladungen; zweitens die sogenannten Wasserstoffbrücken zwischen elektrisch polaren Gruppen; und schließlich dritte "hydrophobe" Bindungen - Wechselwirkungen zwischen unpolaren Gruppen (durch Wasser abgestoßene Gruppen). In der Regel entstehen hier keine stabilen chemischen Bindungen, da jede einzelne der aufgeführten Wechselwirkungen eher schwach ist. Im Allgemeinen bietet das System eines bestimmten Zentrums jedoch eine ausreichende Stärke für die Verbindung von Molekülen. Die oben erwähnte Selektivität der Wirkung bestimmter Zentren wird durch die Entsprechung in der Zusammensetzung und Anordnung chemischer Gruppen im Zentrum und im Partnermolekül erreicht - die sogenannte Komplementarität. Jeder Austausch oder jede Bewegung von Gruppen bedeutet eine Verletzung des Complementary ™. Es ist auch klar, dass ein bestimmtes Zentrum nicht nur ein Arbeitsmechanismus ist, sondern auch eine Chiffre, die es einem Proteinmolekül ermöglicht, seinen Partner unter vielen anderen Molekülen zu „erkennen“, selbst solchen, die große Ähnlichkeit mit diesem Partner haben. Das Konzept spezifischer Zentren spiegelt nur den allgemeinen Charakter der Funktionsmechanismen wider, die Proteinen innewohnen. Die spezifischen Funktionen von Proteinen, die Struktur und die Reaktionen ihrer spezifischen Zentren bleiben ein Bereich der Wissenschaft, in dem fast alles noch zu tun ist. Dies gilt auch für die Prozesse der Bildung supramolekularer biologischer Strukturen. Einige biologische Strukturen sind äußerst komplex. Dies sind beispielsweise Membranen mit * enzymatischen Komplexen. Der Aufbau solcher Strukturen erfolgt, wie die Daten anderer Studien zeigen, durch ein großes System zahlreicher Proteinkomponenten.Die Beteiligung vieler Proteine an dieser Arbeit ist anscheinend nur indirekt - sie sind nur am Prozess der Strukturbildung beteiligt, aber nicht in ihrer Zusammensetzung enthalten. Es wird angenommen, dass es unter diesen akzessorischen Proteinen spezifische Enzyme gibt. Andererseits gibt es biologische Strukturen, die eine relativ einfache Struktur haben. Beispielsweise werden andere faserige Strukturen aus Proteinmolekülen nur eines Typs aufgebaut. In einigen Fällen ist es in Laboratorien möglich, einfache biologische Strukturen in ihre einzelnen Elemente - Protein und andere Moleküle - zu zerlegen. Unter geeigneten Umgebungsbedingungen werden diese Elemente wieder in der richtigen Reihenfolge kombiniert und bilden die ursprüngliche Struktur wieder. Dieser Wiederherstellungsprozess wird üblicherweise als Selbstorganisation bezeichnet. Eine Reihe von Forschungsteams im Ausland und in unserem Land untersuchen ihre Mechanismen. Eine solche Gruppe ist das Labor für Proteinstrukturen und -funktionen des Instituts für Biochemie, in dem die Selbstorganisation von Fibrinfasern untersucht wird. Unter günstigen Bedingungen für den Körper im Blut, das durch intakte Gefäße zirkuliert, gibt es einen löslichen Vorläufer von Fibrin - das Protein Fibrinogen. Wenn Blutgefäße beschädigt sind, beginnt ein spezielles komplexes Proteinsystem, das Enzym Thrombin zu produzieren, das vier kleine Partikel, sogenannte Fibrinpeptide, von einem großen Fibrinogenmolekül abspaltet. Wenn Fibrinogen verloren geht, verwandelt es sich in Fibrin-Protein, dessen Polymerisation (Verbindung miteinander) der Moleküle Fasern bildet. Monomere Fibrinmoleküle polymerisieren mit einer strengen Ordnungseigenschaft aller Selbstorganisationsprozesse. Experimentelle Studien zu Selbstorganisationsprozessen erfordern Lösungen Das erste Problem, das vor Wissenschaftlern auftritt, die sich mit Selbstorganisationsprozessen befassen, ist daher genau der "Abbau" biologischer Strukturen. In jedem Einzelfall muss nach für jede Struktur spezifischen Wirkungsmethoden gesucht werden, die die Bindungen zwischen ihren Monomerbestandteilen effektiv aufbrechen und die Monomere selbst nicht schädigen würden. Für Fibrin war es lange Zeit nicht möglich, einen völlig zufriedenstellenden Weg zur Zersetzung seiner Polymerfasern zu finden. Die ursprünglich für diesen Zweck vorgeschlagenen Lösungen von Harnstoff und dann von Natriumbromid waren unwirksam. Erst 1965 entwickelte ein Mitarbeiter unseres Labors, T. V. Varetskaya, eine Methode, die alle Anforderungen vollständig erfüllt, basierend auf der Verwendung verdünnter Essigsäurelösungen bei Temperaturen nahe 0 ° C. Die auf diese Weise erhaltenen monomeren Fibrinmoleküle haben immer die gleichen Eigenschaften, die von Experiment zu Experiment reproduziert wurden Erfahrung. Die bisherigen Methoden zur Zersetzung von Fibrin in Lösungen von Harnstoff oder Natriumbromid ergaben keine solche Beständigkeit der Eigenschaften: Verschiedene Proben des mit ihrer Hilfe erhaltenen monomeren Proteins unterschieden sich beispielsweise in unterschiedlichen Polymerisationsgeschwindigkeiten. Interessanterweise ergeben die besten Ergebnisse (wie die amerikanischen Wissenschaftler, die die Selbstorganisation dieser Strukturen untersuchten) auch eine gekühlte verdünnte Essigsäurelösung, wenn ein anderes Protein, das Strukturprotein der Mitochondrien, in gelöstem Zustand erhalten wird. Die Prozesse der Selbstorganisation von Strukturen werden auf verschiedene Weise untersucht.Eine dieser Möglichkeiten ist eine systematische Untersuchung der Ergebnisse der Beeinflussung des Prozesses bestimmter Substanzen. Beispielsweise kann eine Verzögerung der Fibrinpolymerisation verursacht werden, wenn die anfängliche Monomerlösung einer wässrigen Lösung anorganischer Salze, insbesondere Natriumchlorid, ausgesetzt wird. Innerhalb der Grenzen niedriger Salzkonzentrationen - bis zu 2-3% - ist die Verzögerung der Polymerisation umso stärker, je "stärker" die Lösung ist. Welche Informationen liefert diese Tatsache? Es ist bekannt, dass Salze in einer wässrigen Lösung in Form von Ionen vorliegen, die positive und negative elektrische Ladungen tragen. Die elektrostatische Effizienz von Salzionen wird normalerweise durch eine spezielle Menge - Ionenstärke - geschätzt, die die Konzentration der Lösung und die Größe der Ladung ihrer Ionen berücksichtigt. Die chemische Natur der einzelnen Salzionen spielt hier keine Rolle. Die Polymerisationsverzögerung wird hauptsächlich durch die Ionenstärke der der monomeren Proteinlösung zugesetzten Salzlösung bestimmt. Dies zeigt, dass der Effekt überwiegend elektrostatischer Natur ist. Offensichtlich screenen ("löschen") Salzionen die elektrischen Ladungen monomerer Fibrinmoleküle - ein Umstand, der nur darauf hinweist, dass ihre elektrischen Ladungen am Mechanismus der selektiven Verbindung von Proteinmolekülen beteiligt sind. Unter normalen Bedingungen - ohne Interferenz durch elektrostatisch geladene Salzionen - sollten positiv und negativ geladene Ionengruppen, die sich in bestimmten Zentren komplementär befinden, Moleküle aneinander ziehen. Detailliertere Studien, die in unserem Labor von E. V. Lugovskii durchgeführt wurden, zeigten, dass neben dem allgemeinen Screening-Effekt der Ionenstärke ein weiterer Effekt von Salzen auftritt, der stark von der chemischen Natur und der Individualität der Ionen abhängt und durch ihre Fähigkeit zur Bindung an ein Protein bestimmt wird. Die Anlagerung eines Ions an ein bestimmtes Zentrum führt offenbar zu einer zusätzlichen Störung seiner Arbeit. E. V. Lugovsky untersuchte die Wirkung höherer Salzkonzentrationen auf die Polymerisation. Es stellte sich heraus, dass einige Salze stark verzögern, während andere im Gegenteil die Polymerisation beschleunigen. So wirken beispielsweise zwei verwandte Salze, Natriumchlorid und Bromid, gegensätzlich: Das erste beschleunigt und das zweite verzögert den Prozess. Wie Bromid, aber noch stärker, wirkt Natriumiodid wie Chlorid mit unterschiedlichen Stärken - manchmal stärker, dann schwächer - Sulfate, Phosphate und einige andere Salze. Es stellte sich heraus, dass durch die Stärke des beschleunigenden Effekts auf die Fibrinpolymerisation die Salze in einer Reihe angeordnet sind, was mit der seit langem etablierten und bekannten Reihe für das "Aussalzen" (Ausfällen) von Proteinen in Lösungen mit hohen Salzkonzentrationen übereinstimmt. In Experimenten mit Fibrinpolymerisation tritt jedoch noch kein echtes Aussalzen auf, da der Prozess bei Salzkonzentrationen untersucht wird, die immer noch nicht das Aussalzen erreichen. Zusätzlich werden während des Aussalzens die Proteine in Form einer formlosen Masse ausgefällt, und im beschriebenen Fall wurden normale Fibrinfasern gebildet - sie konnten unter Verwendung eines Phasenkontrastmikroskops gesehen werden. Viele Studien haben herausgefunden, dass die Neigung eines Proteins zum Aussalzen durch das Vorhandensein unpolarer Gruppen in seinen Molekülen erhöht wird, die sich nahe an seiner Oberfläche befinden und mit der Umwelt in Kontakt stehen. Je mehr solche Gruppen vorhanden sind, desto geringer ist die Konzentration der Salzlösung, die zum Aussalzen des Proteins ausreicht. Diese bekannten Positionen können verwendet werden, um die Ergebnisse unseres Experiments zu erklären, bei dem sich zweifellos ein Aussalzeffekt manifestiert, der darauf hinweist, dass ein monomeres Fibrinmolekül eine große Anzahl unpolarer Gruppen auf seiner Oberfläche enthalten sollte. Aber wir haben kein wirkliches Aussalzen. Der Aussalzeffekt manifestiert sich nur in der Beschleunigung der spezifischen Polymerisation. Dies kann nur durch die Tatsache erklärt werden, dass unpolare Gruppen komplementäre Komponenten eines bestimmten Zentrums des Proteinmoleküls sind. Untersuchungen zur Wirkung von Salzlösungen auf die Fibrinpolymerisation zeigen daher, dass sowohl elektrostatische Wechselwirkungen als auch „hydrophobe“ Wechselwirkungen zwischen unpolaren Gruppen am Prozess der Fibrin-Selbstorganisation beteiligt sind. Die Daten anderer Studien zeigen, dass auch die dritte Art von Wechselwirkungen zwischen Proteinmolekülen beteiligt ist - Wasserstoffbrücken. Wenden wir uns nun Fibrinogen zu, dem Vorläufer von Fibrin. Seine Moleküle können auch polymerisieren, um fibrinähnliche Fasern zu bilden. Daher haben Fibrinogenmonomere auch spezifische Zentren. Ihre Polymerisation erfordert jedoch spezielle Bedingungen und insbesondere eine hohe Ionenstärke der Lösung. Wenn die Abschirmung elektrischer Ladungen die Fibrinpolymerisation verzögert, ist dies im Gegenteil eine Voraussetzung für die Kombination von Fibrinogenmonomeren in der Kette. Daraus folgt jedoch, dass der Ort elektrischer Ladungen in einem bestimmten Zentrum des Fibrinogenmoleküls für die Polymerisation ungünstig ist und nur durch die Wechselwirkung jener chemischen Gruppen durchgeführt werden sollte, die keine elektrische Ladung haben. Fibrinpeptide, bei deren Spaltung das Fibrinogenmolekül zu einem monomeren Fibrinmolekül wird, tragen negative elektrische Ladungen. Anscheinend ist ihre Entfernung der Faktor, der das Ladungssystem in einem bestimmten Zentrum verändert und Komplementarität schafft. Interessanterweise wird eine der Arten von Blutungen, eine schwere Erbkrankheit, durch eine Mutationsänderung des Fibrinogens verursacht, bei der dieses Protein seine positiven Ladungen nahe den Spaltpunkten der Fibrinpeptide verliert. Letztere werden wie im Normalfall gespalten, aber Thrombin bewirkt keine Aktivierung von Fibrinogen mehr. (Wie das Diagramm zeigt, besteht die Aktivierung darin, dass eine nahegelegene positive Ladung eines bestimmten Zentrums von der neutralisierenden Wirkung des Fibrinpeptids freigesetzt wird. Wenn keine solche Ladung vorhanden ist, dann wird die Spaltung des Fibrinpeptids bedeutungslos: eine Aktivierung findet nicht statt.) Bestimmte Fragmente von Fibrinogen oder Fibrin sind durch defekte spezifische Zentren gekennzeichnet, die jedoch selektiv mit monomerem Fibrin interagieren können. Solche Fragmente können durch Zerstörung dieser Proteine durch Enzyme erhalten werden. In Experimenten mit ihnen ist es leicht zu beobachten, wie aktive Fragmente mit Fibrin interagieren und die Anordnung von Fasern stören. Genau an diesen Experimenten - der Herstellung und Untersuchung aktiver Fragmente - ist unser Labor derzeit beteiligt. Wir hoffen, dass wir durch die Untersuchung der Struktur und der selektiven Reaktionen dieser Fragmente besser verstehen, wie Proteine selbst aufgebaut sind und funktionieren. Die Komplementarität ionischer Gruppen, die bei der Selbstorganisation von Fibrin eine so wesentliche Rolle spielt, ist offenbar auch bei der Selbstorganisation anderer biologischer Strukturen wichtig. Der Anteil der Energie elektrostatischer Bindungen an der Gesamtmenge der Wechselwirkungsenergie der Verbindungsmoleküle ist wahrscheinlich gering. Wesentlicher für die Verbindung von Molekülen sind "hydrophobe" Bindungen. Ionengruppen können jedoch die Selbstorganisation beschleunigen. Elektrostatische Ladungen können über eine relativ große Entfernung interagieren. Und es ist ihre weitreichende Aktion, die es wahrscheinlich ermöglicht, die Umgebung zu "untersuchen", den gewünschten Partner zu erkennen und ihn auf orientierte Weise zu kontaktieren. Dies legt nahe, dass beim Aufbau sehr komplexer Strukturen, die in mehreren Stufen stattfinden, auch bestimmte Enzyme wie Thrombin wirken müssen.Die folgende Reaktionsfolge ist leicht vorstellbar: Ein Vorläuferprotein, das beispielsweise an zwei Assemblierungsreaktionen teilnehmen soll, wird durch das erste Enzym aktiviert und verbindet sich mit einem bestimmten Partner; Dies macht es für das zweite Enzym und die anschließende spezifische Bindung des zweiten Partners verfügbar. Es ist möglich, dass dies genau der Organisationsmechanismus dieser biologischen Strukturen ist, deren Komplexität die Möglichkeit einer direkten Selbstorganisation ausschließt. In den Zwischenstadien des Aufbaus komplexer Strukturen können Enzyme nicht nur Aktivierungswerkzeuge sein. Ihre Wirkung kann die allgemeinen Eigenschaften von Proteinen verändern. Beispielsweise kann ein bestimmtes Protein, das bereits in eine Struktur „eingebettet“ ist, ein unlöslicher Teil davon werden, da es aufgrund von Enzymen einen erheblichen Teil seiner hydrophilen Komponenten verloren hat. Natürlich schließt ein solches Schema andere nicht aus, was die Möglichkeit der Existenz von Trägerproteinen impliziert, die unlösliche Proteine an die Versammlungsstelle liefern. Zusammenfassend ist anzumerken, dass die Untersuchung der Assemblierungsprozesse supramolekularer biologischer Strukturen ein Feld voller unklarer und komplexer Fragen ist. In diesem Stadium seiner Entwicklung sind daher Informationen über die Prozesse, die in relativ einfachen Systemen wie dem System zur Bildung von Fibrinfasern ablaufen, besonders interessant und nützlich. V. Belitser Ähnliche Veröffentlichungen
|
| Physiologische Zweidimensionalität von Informationen: Mechanismen und Konsequenzen | Test mit L-Dopa |
|---|
Neue Rezepte
 Die moderne Biologie ist tief in die Tiefen der Zelle eingedrungen - der „Ziegelstein“ der Lebenden. Eine lebende Zelle erschien den Wissenschaftlern als eine harmonische Kombination einfacherer Strukturen - Membranen, Röhren, Granulate, faserige Formationen, die aus geordneten Molekülen bestehen, die miteinander verbunden sind.
Die moderne Biologie ist tief in die Tiefen der Zelle eingedrungen - der „Ziegelstein“ der Lebenden. Eine lebende Zelle erschien den Wissenschaftlern als eine harmonische Kombination einfacherer Strukturen - Membranen, Röhren, Granulate, faserige Formationen, die aus geordneten Molekülen bestehen, die miteinander verbunden sind.